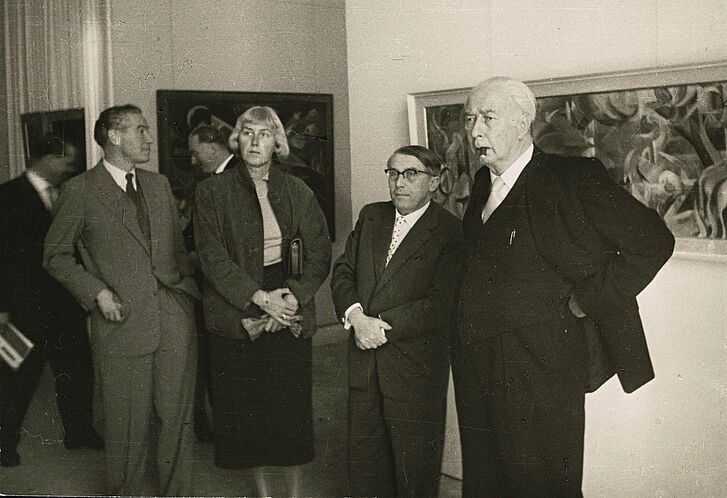Orson Welles starb vor 30 Jahren am 10. Oktober 1985 in Los Angeles nach einem wechselvollen Leben an Herzversagen.
Orson Welles war ein berühmter amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor des 20. Jahrhunderts.
Orson Welles hat Film-, Theater- und Hörspielgeschichte geschrieben. Bis zu seinem Tod hat er in 70 Filmen gespielt und führte in weiteren 12 Filmen Regie. Sechs Filme sind bis heute unvollendet. Welles war ein ewiges Wunderkind, ein Sensationsmacher, eine Skandalfigur, ein Zauberer und ein Spieler.
Die Welt geriet ihm schon früh zur zauberhaften Illusion. Schon in
frühen Jahren ging der begabte Illusionär nach New York, wo er am
Broadway in zahlreichen klassischen Theaterstücken und als
Bühnenregisseur großartige Erfolge feierte.
Im Oktober 1938 wurde
Orson Welles schlagartig durch eine Radioübertragung des Hörspiels »Krieg der Welten« bekannt, welches von der Landung der Marsmenschen auf der Erde in einer dokumentarischen Radiosendung kündete. Welles stellte die
Handlung während der Übertragung dabei so authentisch dar, dass das im Radio übertragene Hörspiel im zahlreichen amerikanischen Grossstädten an der Ostküste für Panik sorgte.
In der Halloween-Nacht 1938 geriet dem Sensationsmacher die Welt zum
großen Spektakel. Es war der Geniestreich des jungen Orson Welles, der
mit diesem Hörspiel-Spektakel Mediengeschichte schrieb. Der Weg nach
Hollywood stand ihm nun offen und er bekam bei dem großen Filmstudio RKO
als Regisseur freie Hand für seine Produktionen.
Als eine Parabel auf das Leben des amerikanischen Zeitungsverlegers
Randolph Hearst entstand Wells' berühmtester Film »Citizen Kane« (1941),
der bis heute als Meilenstein in der Filmgeschichte gilt. Der
Hauptdarsteller John Foster Kane besitzt einen Verlag, ein grosses
Schloss und materiellen Reichtum, doch das Rätsel die Kindheitsinnerung
seiner Jugend, der Schlitten Rosebud, bleibt unerfüllt und ungelöst.

Nach dem Erfolg dieses Filmklassikers stürzte sich Welles als
Regisseur gleich in mehrere Filmprojekte gleichzeitig, von denen er nur
eines - »Der Ruhm des Hauses Amberson« - zu Ende bringen konnte. Sein
Ruf in Hollywood hatte danach sehr gelitten.
»Hollywood ist schon in Ordnung.
Nur die Filme sind halt so schlecht.«
|
Nach drei Filmen in Hollywood hatte Welles bereits seinen Ruf als
Regisseur verspielt. Als Schauspieler hatte er noch Chancen, wenngleich
es schwer war, ihn passend zu besetzen. Von Hollywood enttäuscht verlies
er 1948 Hollywood und ging nach dem Krieg nach Europa, um sich dort
filmischen Produktionen zu widmen.
Die Rolle seines Lebens spielte der Schauspieler Orson Welles 1949 als Harry Lime in dem düsteren Film »Der dritte Mann«, der im geteilten Wien der Nachkriegszeit im Schiebermilieu spielt. Am Tag der Ankunft seines Freundes Holly Martins wird Lime auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Von einem britischen Offizier erfährt Martins, dass ausgerechnet sein alter Schulfreund Lime ein skrupelloser Schwarzhändler gewesen sei.

Ende der 1940er und Anfang der 50er Jahre verfilmte Welles - ein
Mann mit der Präsenz einer Shakespeare-Figur - einige historische
Shakespeare-Stücke wie "Macbeth" (1948) und "Othello" (1951). In Las
Vegas trat er in den 1950er Jahren als Varieté-Künstler als der Magier
"The Great Orsino" auf.

Welles versuchte in Europa seine Film-Projekte selbst zu
realisieren. Er mußte nun als unabhängiger Produzent das Geld zur
Finanzierung seiner Filme selbst beschaffen und auf Kosten seiner
eigenen Existenz arbeiten.
Um das Geld dafür zu verdienen, spielte er in über 100 Filmen mit.
Dass er dabei auch an minderwertigen Projekten mitwirkte – er spielte in
Werbespots mit und synchronisierte billige Zeichentrickserien – ließ
sein Ansehen in der Öffentlichkeit weiter sinken.
Orson Welles gilt dennoch das ewige Wunderkind als einer der besten
Schauspieler und Regisseure des 20. Jahrhunderts. Orson Welles wurde vor
100 Jahren am 6. Mai 1915 in Kenosha im amerikanischen Bundesstaat
Wisconsin geboren.
Seine letzte Ruhestätte fand der Schauspieler in der
südandalusischen Stadt Ronda, die er in den 50er Jahren bei Filmarbeiten
kennengelernt hatte. Dort fand er seine letzte Ruhestätte auf einem
Privatgrundstück. In dem romantischen Honeymoon-Städtchen ist eine
Passage nach ihm benannt.
Dreißig Jahre nach seinem Tod gilt Orson Welles als einer der
wenigen Universalkünstler des Kinos, als eine zentrale Figur des 20.
Jahrhunderts und Persönlichkeit der Zeitgeschichte.
Biografie:

Orson Welles: Genie im Labyrinth von dem österreichischen Filmkritiker Bert Rebhandl
 Orson Welles
Orson Welles von Eckhard Weise
 Das populärste Bild von Jan Vermeer ist das um 1665 entstandene Porträt »Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge«. Das abgebildete Mädchen ist aus unmittelbarer Nähe und ohne erzählerische Attribute dargestellt, was dieses Bildnis von den anderen Werken Vermeers deutlich abhebt. Es ist nicht bekannt, wer die Abgebildete ist. Es könnte sich um ein Modell handeln, vielleicht war das Bild aber auch eine Auftragsarbeit.
Das populärste Bild von Jan Vermeer ist das um 1665 entstandene Porträt »Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge«. Das abgebildete Mädchen ist aus unmittelbarer Nähe und ohne erzählerische Attribute dargestellt, was dieses Bildnis von den anderen Werken Vermeers deutlich abhebt. Es ist nicht bekannt, wer die Abgebildete ist. Es könnte sich um ein Modell handeln, vielleicht war das Bild aber auch eine Auftragsarbeit.



 August Macke: »Mädchen mit Fischglas« (1914), Öl auf Leinwand, 81 x 100,5 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal
August Macke: »Mädchen mit Fischglas« (1914), Öl auf Leinwand, 81 x 100,5 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal






 Dieses weltberühmte Bauwerk in der Nähe von Füssen im Allgäu steht auf einem zerklüfteten Felsen hoch über einer Schlucht. 76 Meter hoch ragt der Achteckturm an der Nordseite des Palas in den Himmel. Die Bauidee hatte der sogenannte Märchenkönig Ludwig II. von Bayern. „Ich habe die Absicht, die alte Burgruine bei der Pöllatschlucht neu aufbauen zu lassen im echten Styl der alten deutschen Ritterburgen.“ So schrieb Ludwig II. an seinen Freund Richard Wagner. Hier, in der Gebirgswelt von Neuschwanstein, wollte sich der König von seinen Alltagsgeschäften zurückziehen, sich eine eigene Welt schaffen.
Dieses weltberühmte Bauwerk in der Nähe von Füssen im Allgäu steht auf einem zerklüfteten Felsen hoch über einer Schlucht. 76 Meter hoch ragt der Achteckturm an der Nordseite des Palas in den Himmel. Die Bauidee hatte der sogenannte Märchenkönig Ludwig II. von Bayern. „Ich habe die Absicht, die alte Burgruine bei der Pöllatschlucht neu aufbauen zu lassen im echten Styl der alten deutschen Ritterburgen.“ So schrieb Ludwig II. an seinen Freund Richard Wagner. Hier, in der Gebirgswelt von Neuschwanstein, wollte sich der König von seinen Alltagsgeschäften zurückziehen, sich eine eigene Welt schaffen.