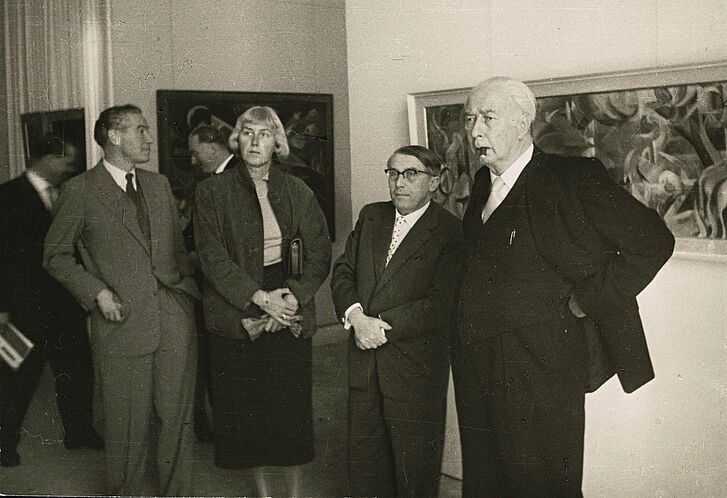Zu Goethes Zeiten war das Reisen eine beschwerliche Angelegenheit, die viel Zeit und Geduld erfordert hat.
Reisen vor 200 Jahren, zu Lebzeiten Goethes, wie war das eigentlich, vor Erfindung von Auto, Zug und
Flugzeug? Welche Transportmittel standen zur Verfügung? Wie sahen damals die Verkehrswege aus?
Die üblichste, preiswerteste, aber wegen des mitzuschleppenden Gepäcks auch anstrengendste Art sich fortzubewegen, war zu Fuß. Das soziale Prestige war dabei gering, was sich u.a. bei der wenig bevorzugten Behandlung in Gasthöfen und Unterkünften zeigte.
Am schnellsten kam man mit dem Pferd vorwärts. Die Möglichkeit Gepäck mitzunehmen war auch hier beschränkt. Größere Distanzen erforderten zudem große körperliche Fitness. Futter und Stall waren teuer, die Unfallgefahr hoch. Wer es sich leisten konnte fuhr in der Regel mit der Kutsche, so auch Goethe, zumindest in seinen reiferen Jahren.
Goethe der Weitgereiste
„Für Naturen wie die meine, die sich gerne festsetzen und die Dinge festhalten, ist eine Reise unschätzbar, sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet“ - „Das ist das Angenehme auf Reisen, dass auch das Gewöhnliche durch Neuheit und Überraschung das Ansehen eines Abenteuers
gewinnt, waren Mottos des Dichters.
Als sich Goethe zu seiner italienischen Reise aufmachte, war er für die damalige Zeit schon weit herumgekommen. Bereits 1775 war er von Frankfurt aus zu seiner ersten Schweizreise aufgebrochen, eine zweite Schweizreise folgte in den Jahren 1779/80. Auch drei Harzexkursionen, jeweils mit Besteigung des Brocken, in den Jahren 1777, 1783 und 1784 fallen in die Zeit vor Goethes großer italienischen Reise.
Straßen und Chausseen
Goethe kannte Straßen vor allem ungepflastert, nach heutigem Verständnis waren es Feldwege. Längs der Route waren entsprechend der Trassenbreite Gräben ausgehoben und der Aushub auf die zukünftige Fahrbahn geschaufelt worden. Nach Möglichkeit wurde mit Sand, Kies oder Steinen nachverdichtet.
Die historischen Straßen für Handel und für Heeresbewegungen, bevor der Chausseebau begann, werden als Altstraßen bezeichnet. Zu großen Teilen waren es unbefestigte Naturwege. Auch die Römerstraßen werden den Altstraßen zugerechnet. Vielfach wurde der Verlauf der Altstraßen der Topografie und den geologischen Formationen der Landschaft angepasst.
Die Routen folgten bevorzugt Höhenrücken (Wasserscheiden) oder verliefen parallel mäßig steiler Hänge. Nach Möglichkeit vermieden die Straßenbauer überschwemmungsgefährdete und sumpfige Fluss-auen. Gefahren konnten von einem gehobenen Standpunkt außerdem früher ausgemacht
werden.
Häufig waren die Altstraßen verkehrsmittelspezifisch mehrspurig. Auf einer Trasse fuhren Reisegespanne, auf dem daneben verlaufenden „Kohlenweg“ Brennholztransporte, es folgte der „Reiterweg“, der „Huckepackweg“ war für Wanderer reserviert. Ein Beispiel für solch ein System ist der „Senner Hellweg“. Gruben sich die Rillen zu tief ein, wurde längs der ausgefahrenen Bahn oft eine neue angelegt. Auch um den Wegezoll zu umgehen bildeten sich immer wieder parallele Schleichwege.
Die verschiedenen Spuren konnten dabei mehrere hundert Meter auseinander liegen.
Weblink:
Reisen zu Zeiten Goethes